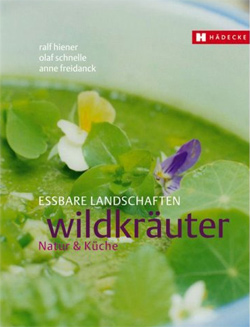Auf Grund des großen Interesses an der Gartenmelde stellen wir nun neben unserem Artikel Gartenspinat und Gartenmelde mit allgemeinen Informationen und Rezepten nun auch eine Kulturanleitung für die Gartenmelde ein.
Arche Noah hat die Gartenmelde übrigens mit 18 verschiedenen Sorten im Vergleichsanbau kultiviert sowie Keimtests und Verkostungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Arche Noah Magazin vom Juli 2012 beschrieben. Die Ausgabe steht auf der Arche Noah Website als PDF zur Verfügung.

Samenstand der Gartenmelde Opera
Die Gartenmelde ist eine historische Spinatpflanze, die es in verschiedenfarbigen Sorten, von hellgrün über rot bis tief violett-braun gibt. Sorten im Handel sind beispielsweise die Rote und die Grüne Gartenmelde oder die hellgrüne Gartenmelde Mondseer. Weitere Sorten sind über Saatgutarchive und private Erhalter erhältlich.
Anbau:
Melden können ab April in Reihen, breitwürfig oder einzeln zwischen anderen Kulturen direkt im Freiland gesät werden. Die einjährigen Pflanzen sind anspruchslos und leicht zu kultivieren, brauchen jedoch volle Sonne. Lässt man die Pflanzen blühen und die Samenstände ausreifen säen sie sich bereitwillig selbst aus.

Grüne Gartenmelde
Wuchsform:
Hochwachsend, viele Sorten werden mit Samenstand über zwei Meter. Zur Beerntung regelmäßig schneiden, es wachsen dann wieder junge Blätter nach.
Vermehrung:
Melden sind Fremdbestäuber und werden durch den Wind bestäubt. Die verschiedenen Meldesorten verkreuzen sich untereinander. Daher immer nur eine Sorte blühen lassen. Auch bei sortenreiner Vermehrung kann es immer wieder zu „Ausreißern“ kommen, die man entfernen sollte. Wird die Pflanze nicht geschnitten bildet sie bis zum Herbst hohe Samenstände mit vielen Samen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Blütentypen: Die vertikalen Blüten sind von zwei Vorblättern umschlossen, der horizontale Blütentyp bildet keine Hüllblätter aus. Die Samen können schwarz oder hellbraun sein. Tests haben gezeigt, dass die hellen Samen schnell keimen wogegen die schwarzen Samen lange im Boden verbleiben können. Sie keimen teilweise erst nach Jahren, wenn sich die passenden Bedingungen ergeben und im Garten erscheinen plötzlich Pflänzchen mit denen man gar nicht mehr gerechnet hat.

Rote Gartenmelde
Verwendung:
Ernte der jungen Blätter am besten vor der Blüte (danach werden die Blätter leicht bitter). Verwendung wie Spinat, für Strudel- und Brotfüllungen oder als Salatbeigabe. Das farbenfrohe Gemüse eignet sich auch gut zur Dekoration z. B. für Büfetts. Rotlaubige Sorten können zum Färben anderer Speisen verwendet werden.
Geschichte:
Melden sind alte Gemüsepflanzen mit weltweiter Verbreitung. Die Kulturform der Gartenmelde kam vermutlich mit den Römern nach Mitteleuropa. Wie andere historische Gemüsepflanzen geriet die Melde mit der Einführung von Kulturpflanzen aus anderen Teilen der Welt immer mehr in Vergessenheit. Vor allem der Spinat hat die Melde weitest gehend ersetzt. VEN (Verein zur Erhaltung der Nutpflanzenvielfalt) ernannte die Melde zum Gemüse des Jahres 2000.
.