Tomaten gehören zu unserem beliebtesten Sommergemüse. Im eigenen Garten angebaut betören sie uns mit Vielfalt und Geschmack. Doch in einem Regenjahr wie diesem (2016) wird die Braun- und Krautfäule schnell zum Spielverderber und die Tomatenliebe wird auf eine harte Probe gestellt.

Galinas Sibirian Cherry
Vielfalt bedeutet Ertragssicherheit
Wir testen seit Jahren verschiedenste alte und samenfeste Tomatensorten auf ihre Freilandeignung und jedes Jahr bringt neue Erkenntnisse.
Zwar dürfte die Wildtomate Humboldtii weiterhin die größte Widerstandsfähigkeit gegen den Braunfäulepilz aufweisen, doch einige großfrüchtigere Sorten brachten in diesem Jahr erstaunliche Ergebnisse.
Neben den Wildtomaten, und den Cocktailtomaten Cuban Pink und Galinas Sibirian Cherry, die sich auch dieses Jahr wieder gut bewähren, haben wir ca. 10 weitere Tomatensorten im Freilandanbau. Zugegeben stehen nicht alle ganz freiwillig im Regen – wir haben es durch unseren Umzug einfach nicht geschafft, rechtzeitig eine entsprechende Überdachung zu bauen. Durch den Regensommer wurden diese Tomaten nun zwangsläufig dem „Braunfäuletest“ unterzogen.
Was sich außerdem sehr schön zeigt: durch die Vielfalt im Anbau bleibt – auch wenn es die eine oder andere Sorte nicht geschafft hat – immer noch eine gute Ernte.
.

Sieger
Alte Tomatensorten können punkten: Sieger ist Sieger
Durch eine gute Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Frühzeitigkeit hat die Tomate Sieger einen hervorragenden Ertrag gebracht und steht noch immer recht gut da. Geschmacklich braucht sie sich dabei nicht zu verstecken.

Tarasenko
Nicht ganz so früh aber mit ebenfalls einem sehr hohen Ertrag hat sich Tarasenko, eine russische Züchtung gezeigt. Wie bei Sieger sind zwar Blätter und einige wenige Früchte befallen, dennoch hält sich der Schaden in Grenzen. Tarasenko eignet sich vorrangig zum Einkochen.

Blue Orange Purple Strip
Überraschungssieger ist Blue Orange Purple Strip, zwar keine alte Sorte, jedoch samenfest. Die sehr wohlschmeckende gelb-lila Tomate leidet bislang kaum unter einem Befall der Braunfäule. Mittelspät reifend stellt sich nun ein guter und gesunder Ertrag ein.
Ebenfalls im Mittelfeld mit mäßigem Befall der Braunfäule stehen die Bauerntomate aus Honduras, die sich gut für den Frischverzehr eignet und die Eiertomate De Berao, ebenfalls eine gute Einkochtomate. Bei beiden macht der reiche Behang die teilweise befallenen Früchte wett. Zudem treibt die Bauerntomate aus Honduras, wie wir bereits in früheren Jahren feststellen konnten, im Spätsommer nochmal neu und bringt eine zweite späte Ernte, soweit die Witterung einigermaßen passt.
Das Regenwetter am schlechtesten vertragen hat Musk Zebra, eine grün gestreifte Sorte, die eigentlich gut freilandtauglich sein sollte. Leider konnten wir von ihr so gut wie keine Frucht ernten und die Pflanzen sind bereits komplett abgestorben. Ein erneuter Anbau wird wohl nur noch geschützt erfolgen.
Wer sich mal wieder um den Regentest gedrückt hat, ist die Kartoffelblättrige Tiefgefurchte. Sie soll laut Gerhard Bohl eine der wenigen im Freiland widerstandsfähigen Fleischtomaten sein. In jedem Anbaujahr hatten wir bislang wenig Regen und viel Sonne – und schöne Tomaten im Freiland. Sollten wir sie nächstes Jahr wieder in Anbau nehmen, gibt es bestimmt einen Bombensommer 🙂 !
Saatgut der genannten alten und samenfesten Tomatensorten kann bei uns im Online-Shop bestellt werden. Von allen Tomaten kann Saatgut für den eigenbedarf gewonnen werden.
Tomaten im Online-Shop von Garten des Lebens >
Alte Tomatensorten selbst vermehren >
.



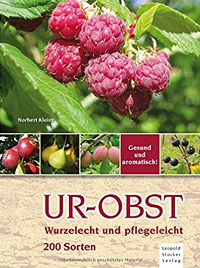 Norbert Kleinz
Norbert Kleinz Klimaneutral heißt nicht nur auf künstliche Düngemittel verzichten, die unter hohem Energieaufwand hergestellt werden, sondern ebenso Transportwege für Lebensmittelimporte und Energiekosten für geheizte und mit Zusatzbeleuchtung ausgestattete Gewächshäuser zu vermeiden.
Klimaneutral heißt nicht nur auf künstliche Düngemittel verzichten, die unter hohem Energieaufwand hergestellt werden, sondern ebenso Transportwege für Lebensmittelimporte und Energiekosten für geheizte und mit Zusatzbeleuchtung ausgestattete Gewächshäuser zu vermeiden. Dekan zeichnet sich mit ihren kurzen, bis zu 15 cm langen walzenförmigen Früchten durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mehltau aus und kommt gut mit schwankenden und auch mal kühleren Nachtemperaturen zurecht.
Dekan zeichnet sich mit ihren kurzen, bis zu 15 cm langen walzenförmigen Früchten durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mehltau aus und kommt gut mit schwankenden und auch mal kühleren Nachtemperaturen zurecht.
 Die reifen Früchte der Länge nach aufschneiden und die Samen heraus schaben, abwaschen und trocknen lassen. Um die keimhemmende Schicht um die Samen abzubauen, kann auch für ein bis zwei Tage die Nassvergärung eingesetzt werden.
Die reifen Früchte der Länge nach aufschneiden und die Samen heraus schaben, abwaschen und trocknen lassen. Um die keimhemmende Schicht um die Samen abzubauen, kann auch für ein bis zwei Tage die Nassvergärung eingesetzt werden.